Jonas Cohn (1869 – 1947)
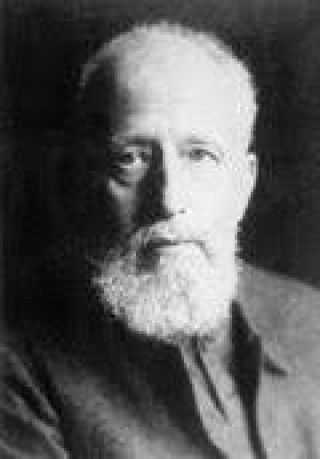
„Das ‚Denkfremde‘ ist von Anfang an und bleibt der Gegenpol zu einem ‚Denkeigenen‘. Denken findet zu seiner Form nur dort, wo ihm eine Inhaltlichkeit Widerstand leistet. Diesen Widerstand seinerseits mitdenken wollen, obwohl er kein Denken ist, macht Cohn zu seinem Ziel. Daher ist seine Formenlehre der Philosophie eine Theorie der Dialektik. Das Denkfremde provoziert geradezu den ‚Ursprung der Dialektik‘. (...) Das Denkfremde ist eine vielgestaltige, nicht formalisierbare Gegeninstanz zur Denkform. Trotzdem gibt es einen gemeinsamen Fokus in diesem Vielen: die Identität eines Gegenstandes. Für die ‚Möglichkeit beliebiger Gegenstandsbildung‘ braucht es ein ‚Minimum der Denkfremdheit‘ (...) ohne das überhaupt kein Gegenstand gebildet, also auch nicht geurteilt werden kann.“
Hartwig Wiedebach, Vorrecht der Bejahung vs. Urteil des Widerspruchs, in: Marburg versus Südwestdeutschland, Christian Krijnen / Andrzej Noras (Hrsg.), Königshausen & Neumann, 2011, S. 163ff.
„Cohns Verständnis von Dialektik kann auch mit Hilfe der beiden Grundsätze, die er fast bekenntnishaft vertreten hat, nämlich des Grundsatzes des Utraquismus und der Prävalenz des Positiven, näher bestimmt werden. Besagt die Prävalenz des Positiven, ‚daß im philosophierenden Denken kein gegebener Inhalt unterdrückt werden darf‘, so bedeutet umgekehrt der Utraquismus, ‚daß beides: die Form des Denkens und der relativ denkfremde Inhalt als gleich ursprüngliche konstitutive Elemente des Erkennens jeder Art, der Tatsachen wie der Werterkenntnis angesehen werden müssen‘. Erweist sich der Utraquismus als dasjenige Element, das weitertreibt zur Dialektik, so legt umgekehrt die Prävalenz des Positiven dieser Dialektik, wie Marck sagt, ‚kritische Bremsen‘ an.“
Hans-Ludwig Ollig, Der Neukantianismus, Tübingen, J. B. Metzler Verlag 1979, S. 85f.
„Die utraquistische Lehre macht Cohn nun wissenschaftstheoretisch fruchtbar, und zwar in höchst sachkundiger Weise sowohl für die Philosophie der Mathematik wie der empirischen Wissenschaften. Wie Flach zu zurecht betont, füllt er damit eine empfindliche Lücke in der Ausführung der Schuldoktrin. Mathematiktheoretisch konzentrieren sich seine Untersuchungen auf das Problem der Konstruktion. Im Unterschied zur Mathematik ist Wirklichkeitserkenntnis nicht vollendbar.“
Helmut Holzhey in: Helmut Holzhey / Wolfgang Röd, Die Südwestdeutsche Schule, in: Geschichte der Philosophie Band XII, München, C. H. Beck Verlag 2004, S. 117.
„Der erkenntnistheoretische Satz des >Utraquismus< - wie Jonas Cohn ihn formuliert hat - könnte in diesem Sinn durchaus zugestanden werden: mit der Einschränkung, daß die gegensätzlichen Momente der Identität und Verschiedenheit, der Form und des Inhalts gleich notwendige und unentbehrliche Züge in der Einheit des Denkens selbst sind. Es handelt sich hier nicht um den Gegensatz zwischen einem rein logischen und einem schlechthin alogischen Bestandteil, zwischen dem Denken in seiner reinen Betätigung und einem schlechthin ‚denkfremden‘ Stoff, auf den es stößt... Wo immer man den Gesamtgehalt der Erkenntnis aus reinen Tätigkeiten des Denkens und einer gegebenen denkfremden ‚Materie‘ zusammensetzt, da entsteht immer von neuem das unlösbare Problem, wie es zu erklären ist, daß diese beiden, gegeneinander indifferenten Bestandstücke dennoch miteinander kongruieren‘ und gleichsam aufeinander passen.“
Ernst Cassirer, Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik, in: Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe, Band 9, (Hrsg.) Birgit Recki, Meiner Verlag 2001, S. 154.
„Die Rolle, die der dem Erkennen doch fremde Anspruch der Anschauung spielt, sobald der Begriff erfüllt werden soll, weist darauf hin, daß das Wertgebiet des Erkennens, als menschliches Wertgebiet gedacht, ergänzungsbedürftig bleibt. Daß diese Ergänzungsbedürftigkeit mit dem Utraquismus zusammenhängt, ist bisher mehr eine Vermutung als eine deutliche Erkenntnis. Wir müssen versuchen es dazu zu erheben. In jedem Urteil finden sich beide Evidenzanteile, aber so, daß keiner von beiden ohne den anderen irgendwie erfaßt werden kann. Ihre Trennung gelingt nur dadurch, daß sie unabhängig variiert werden können, d. h. daß der gleiche Anteil der Denkform mit verschiedenen Denkfremdheiten zusammentreffen kann. (...) In der Denkfremdheit nun enthält jedes Urteil etwas rational Unaufgelöstes. Die vielen unterscheidbaren Etwas bezeichnen diese Grenze selbst in den logischen Grundsätzen und in den Sätzen der reinen Arithmetik. So ist jede Erkenntnis von etwas abhängig, das ihr eine Grenze setzt. Die ganze Fülle dieses Denkfremden nun, das doch durchformt werden soll, ist nie beherrschbar. Dadurch folgt aus dem Utraquismus der Voraussetzungen die Idealität der Ziele.“
Jonas Cohn, Voraussetzungen und Ziele des Erkennens: Untersuchungen über die Grundfragen der Logik, Leipzig 1908, S. 466f.
„Das soeben charakterisierte Temperament J. Cohns prägte sich in zwei eng miteinander verflochtenen Grundsätzen aus, die bei ihm einen fast bekenntnishaften Charakter haben: die Prävalenz des Positiven und der Utraquismus. Der erstgenannte Grundsatz formuliert das Postulat, daß im philosophierenden Erkennen kein gegebener Inhalt unterdrückt, wegkonstruiert und gleichsam unterschlagen werden darf. Utraquismus bedeutet, daß beides: die Form des Denkens und der relativ denkfremde Inhalt als gleich ursprüngliche konstitutive Elemente des Erkennens jeder Art, der Tatsachen - wie der Werterkenntnis, angesehen werden müssen. Der Utraquismus macht diese Philosophie dialektisch, die Prävalenz des Positiven legt dieser Dialektik kritische Bremsen an. Im Bereich der Erkenntnis ist das Gegebene dem Denken und nur dem Denken gegeben. Damit steht es im Sinne der transzendentalen Affinität unter der Gesetzlichkeit der Denkform. Indessen gibt ihm die Unableitbarkeit aus der Denkform den Beisatz von Denkfremdheit.“
Siegfried Marck, Am Ausgang des jüngeren Neukantianismus, in: Hans-Ludwig Ollig, Materialien zur Neukantianismus-Diskussion, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987, S. 39f.
„Während Cohn im Gegensatz von ‚Sinnlichkeit und Verstand‘ eine ‚ziemlich primitive Psychologie‘ erblickt, die mit unklaren Vermögensbegriffen arbeite und diese mit Wertgesichtspunkten verquicke (1908, 99), kommt es ihm an auf die ‚logische Fragestellung‘ nach der Geltung der Erkenntnis und auf die Funktion, die Form und Inhalt dabei spielen. Bezeichnenderweise begreift Cohn seinen dualistischen Ansatz von Denkform und denkfremdem der Erkenntnis, d. i. seinen ‚Utraquismus‘, dem ‚Gehalt‘ nach als eine ‚Fortbildung‘ von Kants Diktum ‚Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind‘ (KrV B 75). Im Geiste Kants würden u. a. die mißverständliche Rede von reinen Anschauungsformen und die Entgegensetzung von Anschauung und Begriff überwunden.“
Christian Krijnen, Das konstitutionstheoretische Problem der transzendentalen Ästhetik, in: Marion Heinz / Christian Krijnen, Kant im Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007, S. 122f.
„Auch nach dieser Seite hin erfährt also der anfängliche scharfe Gegensatz, der durch die Grundansicht des ‚Utraquismus‘ gesetzt schien, eine erhebliche Abschwächung. Denn das ‚Denkfremde‘ ist, wie sich nunmehr zeigt, keineswegs auch - erkenntnisfremd, sondern gilt durch den Begriff der Erkenntnis selbst als gefordert. Es erscheint nicht als ein bloß ‚Gegebenes‘, sondern als ein Moment, das sich einsichtig verstehen und begründen läßt. Damit aber ist dem kritischen ‚Rationalismus‘ - der ja ein Rationalismus des Erkennens, nicht des bloß abstrakten und formalen ‚Denkens‘ sein will - wiederum alles zugestanden, dessen er zur Durchführung seines Grundgedankens bedarf.“
Ernst Cassirer, Jonas Cohn - Voraussetzungen und Ziele des Erkennens (1910), in: Ernst Cassirer, Gesammelte Werke, Hamburger Ausgabe, (Hsg.) Birgit Recki, Band 9, Meiner Verlag, Hamburg 2001, S. 466.
Bedeutende Werke:
Geschichte des Unendlichkeitsproblems im abendländischen Denken bis Kant, Leipzig 1896
Allgemeine Ästhetik, Leipzig 1901
Voraussetzungen und Ziele des Erkennens. Untersuchungen über die Grundfragen der Logik, Leipzig 1908
Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Ein philosophischer Versuch, Leipzig 1914
Theorie der Dialektik. Formenlehre der Philosophie, Leipzig 1923
Wertwissenschaft, Stuttgart 1932
Biographie: https://www.deutsche-biographie.de/sfz8566.html
Jonas-Cohn-Archiv: http://www.steinheim-institut.de/wiki/index.php/Archive:Jonas-Cohn-Archiv
- Literatur (Anregungen):
Der Neukantianismus (1979) Hans-Ludwig Ollig
Geschichte des Neukantianismus (2020) Andrzej J. Noras
Kritische Dialektik und Transzendentalontologie (1995) Kurt Walter Zeidler
Selbst-Überschreitung: Grundzüge der Ethik - entworfen aus der Perspektive der Gegenwart (1986) Jonas Cohn / Dieter-Jürgen Löwisch (Herausgeber)